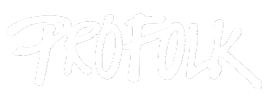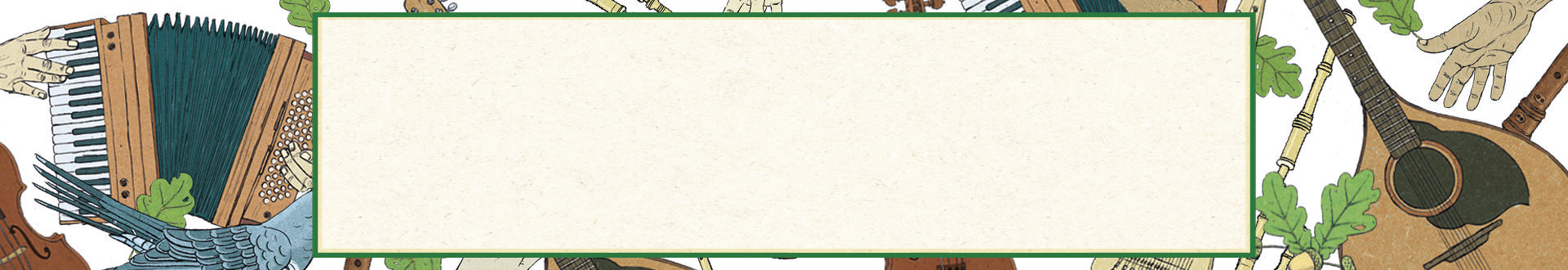„Spielst du schon Waldzither?“ Das war der Running Gag beim KlangRauschTreffen 2023. Da konnte ich meine Freude kaum bremsen, auch wenn mir die Ironie nicht entging. Doch es musste viel Wasser die Ilm hinunterfließen bis zu dieser wohlgemeinten Spöttelei und der jetzt vorliegenden Anmeldung als immaterielles UNESCO-Kulturerbe.
Aber Schritt für Schritt, worum geht es überhaupt? Wir reden hier von der Renaissance eines heimischen Cisterinstruments mit einer fast fünfhundertjährigen Geschichte. Seine Geschwister sind beispielsweise die Bouzouki oder die portugiesische Guitarra de Fado. Aber die Waldzither hat, bis auf den Namen, wenig gemein mit der alpinen Tischzither. Diese Kastenhalslaute besitzt den typischen birnenartigen Korpus, trägt neun Stahlsaiten (vier doppelchörige, eine Basssaite) und ist akkordisch gestimmt, meist auf C-Dur. Sie wurde in Mitteldeutschland viel gebaut und gespielt, speziell im Thüringer Wald. Und so nannte man sie vor circa hundertfünfzig Jahren eben Thüringer Waldzither. Ein Urahn der mitteldeutschen Cistern oder Zithern wurde bei Renovierungsarbeiten im Freiberger Dom in der Montanregion Sachsens entdeckt. Auf dem Obergesims steht dort eine Gruppe von Engelchen mit diversen Instrumenten aus der Zeit um 1590. Als man dem vergoldeten Knaben sein ebenfalls vergoldetes Cisterchen aus der Hand nahm, staunte man nicht schlecht. Es war ein echtes und viel gespieltes Instrument. Das war sinnfällig, denn Träger der Cistertradition in Sachsen waren die Bergleute.
Wann das Instrument in Thüringen heimisch wurde, ist nicht genau zu datieren. Fakt ist, dass Johann Sebastian Bach über seinen Vorfahren Veit Bach (c. 1550-1619) schrieb, er habe „sein meistes Vergnügen an einem Cythringen gehabt“. Die direkten Waldzither-Vorläufer werden als „Thüringer Zistern“ bezeichnet und sind unter anderem im Bachhaus Eisenach, im Grassimuseum Leipzig oder im Waffenmuseum Suhl zu bestaunen. Offenbar baute man um 1800 fleißig derartige Neunsaiter, welche die Basssaite(n) meist noch neben dem Griffbrett als Bordun trugen. Die Gebrauchsspuren zeigen, dass man auf den Instrumenten vor allem akkordisch zu Werke ging, meist mit Barré-Griffen. Auch wenn in den 1870er-Jahren die ersten Schulen für Thüringer Waldzither erschienen, wurde sie durch das Modeinstrument Gitarre zunehmend verdrängt. Selbst die Spielweise war bereits sehr vom Biedermeier-Zeitgeist und der Gitarre beeinflusst. (Text: Tim Liebert veröffentlicht im folker 01.24)
Link zur umfangreichen Seite des Waldzithervereins: www.waldzither.org
Ansprechpartner:innen der AG Waldzither:
Tim Liebert – tim.liebert@profolk.de
Thomas Strauch – thomas.strauch@profolk.de